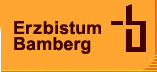31. Sonntag im JahreskreisPredigt zu Mt 23,1-12 – DemutDas Evangelium des 31. Sonntags im Jahreskreis (Lesejahr A): Mt 23, 1-12In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun; denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen: Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang, bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben, und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich grüßen und von den Leuten Rabbi - Meister - nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Predigt„BORGIA“ – Dieser Name ist seit einiger Zeit immer wieder zu hören. Die gleichnamige sechsteile Serie im ZDF und die Berichterstattung um sie herum ist in vieler Munde. „Kann das denn wahr sein?“ – fragen sich nicht wenige. Sie sind erschüttert angesichts der gezeigten Gewaltexzesse, der moralischen Verkommenheit, der verachtenswerten Etablierung des Bösen im Vatikan im Rom das 15. Jahrhunderts. Papst Alexander VI. – der Borgia-Papst. Entspricht all das, was uns eindrucksvoll aufbereitet durchs Fernsehen dieser Tage ins Haus gesendet wird, der Wirklichkeit? Waren Papst und Kurie tatsächlich auf derart erschreckenden moralischen Abwegen unterwegs; einerseits fromm und anderseits kaltblütige Mörder, gnadenlose Strippenzieher, gewalttätige Machtpolitiker und moralisch auf den Hund gekommen? Der Vatikan ein Sündenpfuhl? Ja, auch dieses Kapitel der Kirchengeschichte ist leider ein Teil der Tradition unserer Kirche, auch wenn zwischen filmischer Darstellung und historischen Tatsachen die eine oder die andere Diskrepanz besteht. Ja, man kann durchaus nachdenklich werden – und viele sind es. Man kann Vorurteile bestätigt finden – und viele tun genau dieses. Man kann durch all das erneut ins Fragen kommen: - nach der moralischen Integrität der Kirche,
- nach der Umsetzung der Botschaft Jesu durch ihre amtlichen Vertreter,
- nach dem, was damals war und wie es heute ausschaut.
- Man kann neu nachdenken über Macht und Herrlichkeit der Kirche, über Privilegien und Einflussnahme,
- über Moral und wie sie heute von den kirchlichen Exponenten gelebt wird.
Der Zeigerfinger schnellt vielleicht schnell nach oben – und ein Urteil ist leicht gefällt. „Ja, so sind sie, die ach so frommen Kirchenmänner…“ Wie eine biblische Interpretation der Borgia-Filmreihe liest sich dann das heutige Evangelium: Eine Generalabrechnung Jesu mit all den heuchlerisch daherkommenden religiösen Oberen, denen die Show weit wichtiger ist als die innere Haltung; die sich durch ihr frömmlerisches Spiel Anerkennung und Einfluss erwirken wollen. Das alles entlarvt Jesus auf eine unmissverständliche Art, was freilich nicht bei allen Anklang findet. Wer so redet, organisiert sich Feinde. Wohin das letztlich führt, wissen wir: Ans Kreuz. Offensichtlich gab es damals viel Beklagenswertes, jedenfalls in der Schreibweise des Evangelisten Matthäus: - Die Schriftgelehrten und Pharisäer – so Jesu pauschale Kritik – laufen mit breiten Gebetsriemen herum,
- die schmückenden Quasten an ihren Gewändern werden immer länger,
- sie drängen sich nach vorn auf die Ehrenplätze, damit sie gut gesehen werden,
- sie lassen sich gern huldigen, grüßen, loben, umschmeicheln…
- Und bei all dem verkündigen sie das göttliche Gesetz. Sprichwörtlich würden wir heute sagen: „Sie predigen Wasser und trinken selber Wein.“
Das Evangelium ist für mich durchaus ein Stolperstein, der mich fragen lässt, mich Mann in der Kirche heute und hier, wie es um mich, um mein Auftreten, um mein Verhalten bestellt ist. Authentizität und Kohärenz sind gefragt im Blick auf die Botschaft, auf den Lebens- und Arbeitsstil und auf das, was ich verkündige… Ich weiß, dass diese Fragen mich und viele meiner Kollegen, viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Mit der Fokussierung der Aussagen dieser Evangeliumspassage lediglich auf „die da oben“ und „die da vorn“ könnten sich viele entspannt zurücklehnen: „Ich bin ja wohl nicht gemeint!“ Nach allem, was wir sonst vom Evangelisten Matthäus kennen, schreibt er sein Evangelium nicht als Kampfschrift gegen jemanden, gegen die so genannten „Anderen“. Vielmehr hat er ganz bewusst seine Gemeinde im Blick, schreibt er seine Frohe-Botschafts-Zeilen für die Menschen, die in ihrer jeweiligen Situation versuchen, Jesus nachzufolgen. Er schreibt sie auch für uns. Es lohnt sich somit, einen Schritt tiefer in die Evangeliumspassage einsteigen, um auf einen weiteren Botschaftskern zu stoßen. Ein Schlüsselvers sind die Worte, die die Begebenheit abschließen. Jesus: „Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ Diener sein, sich selbst erniedrigen… – Das ist also das Programm! Wie ist dieses „Diener-Für-Andere-Sein“ und sich dabei selbst zu erniedrigen gemeint? Womöglich ist das Bild, das sie von einem Diener haben, geprägt von Büchern und Filmen, die an königlichen Höfen spielen. Diener dort reagieren auf Handzeichen oder Glöckchenklang, unhinterfragt, unverzüglich und punktgenau. Das kann Jesus sicher nicht meinen! Mir kam ein Begriff in den Sinn, der alles andere als populär ist, eher verstaubt und unmodern, in der kirchlichen Spiritualitätsgeschichte leider allzu oft in eine ungute Richtung gedeutet: Demut. Wenn ich Demut sage, dann meine ich nicht grenzenlose Unterwürfigkeit, nicht blinde Gefolgschaft, nicht willenlose Unterordnung oder absolute Selbstaufgabe. Ich meine Demut als eine dem Leben dienende Einstellung, eine innere Haltung, eine Grundhaltung meinen Mitmenschen, Gott und mir selber gegenüber. Demut, wie ich sie verstehe, meint zum einen, dass ich mir vor Augen führe, worauf meine Existenz beruht: mein Geschöpf-Sein, meine Vergänglichkeit, meine Begrenztheit, mein Verwobensein, mein Angewiesensein auf meine Mitmenschen, auf die Umwelt, auf die Gesellschaft, auf Gott. Zum anderen lässt mich diese Demut aber auch erkennen, dass mich Gott einmalig als sein Abbild schuf und ins Leben rief, dass er mich in der Taufe als sein Kind angenommen hat, dass er mit mir durchs Leben geht und treu ist, dass er mir, mir ganz persönlich, Erlösung und Heil schenkt. Es geht darum, sich bewusst machen, woher ich komme und worauf ich angewiesen bin, zugleich aber auch zu erahnen, welch große Würde mir Gott verliehen hat und welches Heil er mir zuspricht. Das ist ein Demutsverständnis, das helfen kann, das eigene Leben gut zu gestalten. Beispielsweise: Ja, ich erkenne an, dass ich als göttliches Menschengeschöpf Grenzen habe – in der Leistungsfähigkeit und der Belastbarkeit. Ich bin nicht Gott. Ich kann nur das, was mir möglich ist – und irgendwann muss Pause oder Schluss sein. Solches Denken macht einen weich, gnädig, barmherzig – sich selber gegenüber und gegenüber anderen. Genau das meinen Mitmenschen zu zeigen, kann zu einem sehr hilfreichen Dienst für sie werden! Oder: Ja, ich erkenne an, dass ich als göttliches Menschengeschöpf zwar zur Vollkommenheit berufen bin – aber als Mensch eben auch Fehler mache, Fehler machen darf. Und dass Gott dies auch im Blick hat, und dass er uns Wege und Möglichkeiten aufzeigt, mit unserer Schuld und unseren Schuldverstrickung umzugehen. Ich muss nicht perfekt sein – aber ich darf mit Gottes Hilfe neue Versuche anpacken, um mich zu entwickeln, zu vervollkommnen. Das gilt mir und ebenso den anderen. Ein solcher von Demut geprägte Blick auf mich und auf andere ist sehr dienlich. Die Atmosphäre im Zusammenleben verliert so an Härte. Oder: Ja, ich erkenne an, dass ich als göttliches Menschengeschöpf zwar in diese Welt gerufen bin, um sie zu gestalten und Spuren zu hinterlassen. Aber ich bin nicht der König, ich muss nicht der omnipräsente Macher, der Überprüfer, der Richter über alle und alles sein. Stattdessen: Ich wirke mit – zusammen mit den anderen, die sich ebenso gerufen und gesendet fühlen. Eine solche von Demut inspirierte Sichtweise ist entlastend, ist tröstlich, tut gut, mir selber und der Welt um mich herum. Ich meine, es wäre nicht das Schlechteste, wenn es uns gelänge, richtig verstandener Demut in unserer Mitte eine Renaissance zu ermöglichen. Dann wird mehr und mehr Wirklichkeit, worum es Jesus in seiner an uns alle gerichteten Frohen Botschaft geht. Ein neues Kapitel unserer Geschichte mit Gott ließe sich aufschlagen… Matthias Bambynek
Pfarrer in Bubenreuth
|